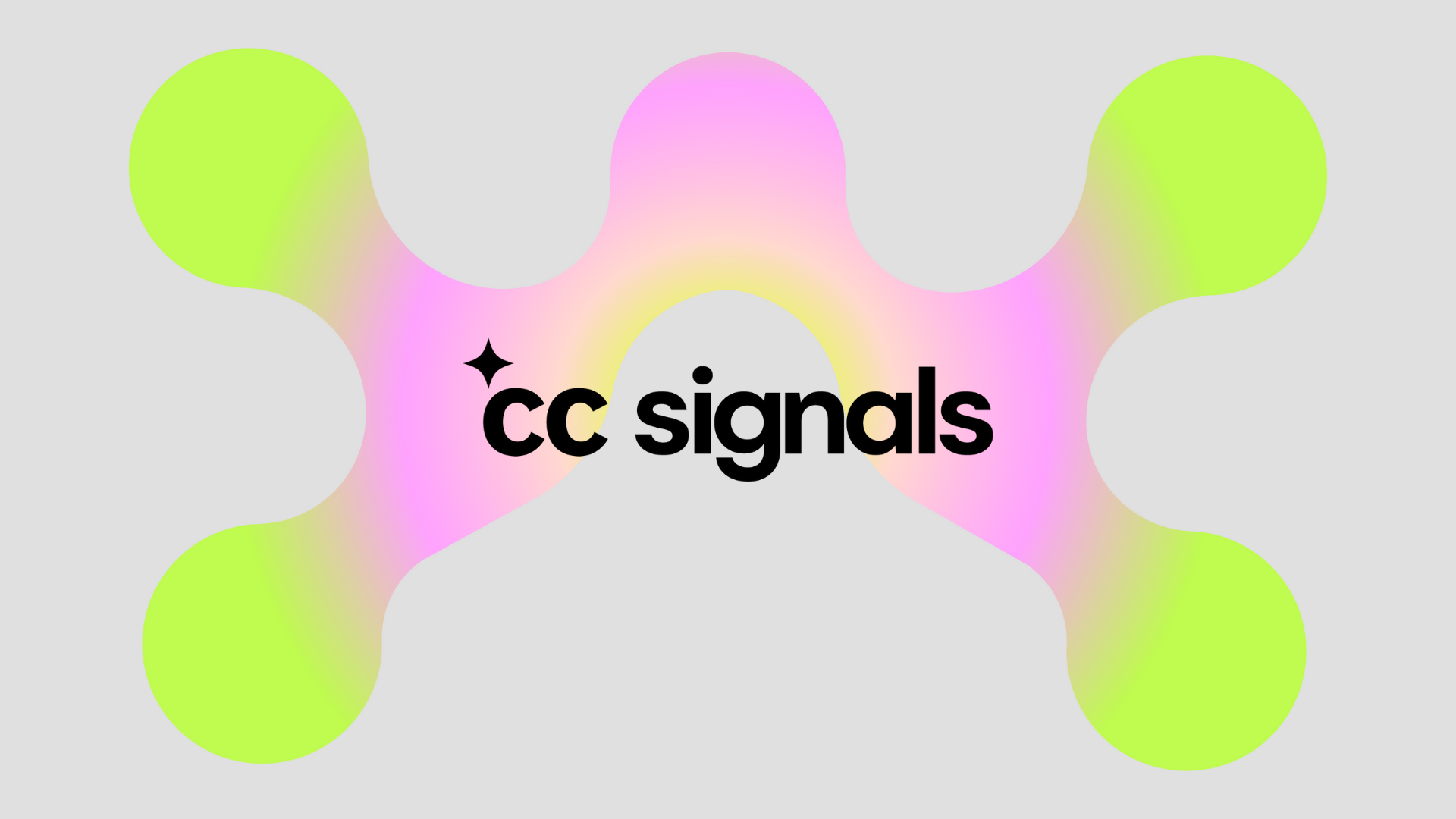Während sich KI-Systeme mit beispielloser Geschwindigkeit durch Millionen von Webseiten, Bildern und Texten fressen, bleiben die Urheber dieser Inhalte oft außen vor – sowohl bei der Entscheidung über die Nutzung als auch bei den Erträgen. Creative Commons (CC) möchte das mit einem neuen Ansatz ändern: den CC Signals, einem Framework, das den Austausch zwischen Dateneigentümern und KI-Entwicklern neu organisieren soll. Um die Tragweite dieses Vorhabens zu erfassen, lohnt sich zunächst ein Blick auf die aktuelle Situation. Das Internet, wie wir es kennen, basiert auf dem Prinzip des offenen Teilens – eine Philosophie, die Creative Commons seit über zwei Jahrzehnten mit ihren Lizenzen unterstützt hat. Milliarden von Werken sind heute unter CC-Lizenzen verfügbar, von Wikipedia-Artikeln bis hin zu wissenschaftlichen Publikationen.
Doch die KI-Revolution hat diese Dynamik fundamental gestört. Während Maschinen schon lange Web-Inhalte durchsuchen – für Suchmaschinen oder digitale Archive –, ist heute etwas anderes geschehen: Die Maschinen nutzen diese Daten nicht mehr nur, um das Web durchsuchbarer zu machen oder neue Erkenntnisse zu erschließen. Stattdessen füttern sie damit Algorithmen, die das Web, wie wir es kennen, grundlegend verändern und bedrohen. Das Problem liegt im Tempo und der Reichweite: KI-Systeme haben in beispielloser Geschwindigkeit Milliarden von Webseiten erfasst, die von Menschen und Gemeinschaften erstellt wurden. Dies geschah jedoch ohne Beteiligung der Content-Ersteller und ging weit über das hinaus, was diese vernünftigerweise erwartet hatten, als sie ihre Werke öffentlich teilten. Das Resultat ist eine Art digitaler Enteignung, die das Fundament des offenen Webs zu untergraben droht. Die Reaktionen auf dieses Problem bewegen sich bislang zwischen zwei Extremen. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die ihre Inhalte komplett abschotten wollen – durch technische Barrieren, Paywalls oder restriktive Lizenzen.
Diese verständliche Reaktion führt jedoch zu einem fragmentierten Internet, in dem Wissen nur noch denjenigen mit den entsprechend finanziellen Mitteln zugänglich wird. Die Gefahr liegt auf der Hand: Wenn alle den Zugang blockieren, verlieren alle. Barrierefreier Zugang zu Wissen bildet das Fundament wissenschaftlicher Entdeckungen und demokratischer Teilhabe. Er wirkt als Gegenmittel zu Falschinformationen und Desinformation. Eine Wende zu restriktiver Lizenzierung würde nicht nur den menschlichen Zugang zu Wissen behindern, sondern auch zu einem weniger fairen, weniger vielfältigen und weniger wettbewerbsfähigen KI-Ökosystem führen.
Auf der anderen Seite gibt es Stimmen, die argumentieren, alles öffentlich verfügbare Material sei automatisch für KI-Training zu prozessieren. Diese Position ignoriert jedoch die berechtigten Interessen der Content-Ersteller und übersieht einen entscheidenden Punkt: Das aktuelle KI-Ökosystem steht nicht mehr im Einklang mit dem gesellschaftlichen Vertrag, der lange die digitalen Commons regierte. Dieser Vertrag basierte auf der Erwartung: Wir teilen offen, aber wir tun dies in der Erwartung von Respekt, Anerkennung und Reziprozität. CC Signals positionieren sich bewusst zwischen diesen Polen. Das Framework erkennt an, dass die Lösung weder in totaler Öffnung noch in kompletter Abschottung liegt, sondern in der Entwicklung differenzierter Mechanismen für Austausch und Reziprozität.
Das technische und soziale Design
CC Signals sind als hybrides System konzipiert, das sowohl technische als auch soziale Funktionen erfüllt. Technisch gesehen handelt es sich um maschinenlesbare Präferenzsignale, die Dataset-Inhaber setzen können, um ihre Vorstellungen über die Verwendung ihrer Inhalte zu kommunizieren. Diese Signale sollen flexibel genug sein, um verschiedene rechtliche, technische und normative Kontexte abzubilden. Entscheidend ist jedoch das zugrundeliegende Prinzip: CC Signals zielen nicht darauf ab, bestimmte Arten von KI-Training oder andere maschinelle Nutzungsformen wie Text- und Data-Mining zu begrenzen oder einzuschränken. Stattdessen sind sie darauf ausgelegt, Gegenleistungen zu incentivieren. Die vorgeschlagenen CC Signals-Elemente spiegeln verschiedene Dimensionen der Reziprozität wider: Anerkennung (Credit), finanzielle Nachhaltigkeit und nicht-monetäre Formen des Beitrags. Die soziale Dimension ist jedoch mindestens ebenso wichtig. CC Signals verstehen sich als Aufruf zu einem neuen gesellschaftlichen Vertrag zwischen denen, die Daten teilen, und denen, die diese für KI-Training verwenden. Das Framework basiert auf der Überzeugung, dass es viele legitime Zwecke für die maschinelle Wiederverwendung von Inhalten gibt, die geschützt werden müssen. Gleichzeitig ist ein Ökosystem möglich und notwendig, das die berechtigten Anliegen derjenigen besser berücksichtigt, die menschliches Wissen erstellen und verwalten.
Die Grenzen des Urheberrechts
Ein wichtiger Aspekt der CC Signals-Initiative ist die Anerkennung, dass das Urheberrecht allein nicht die Antwort auf die Herausforderungen der KI-Ära sein kann. Wie Creative Commons betont, war das Urheberrecht nie dafür gedacht, KI-Training zu kontrollieren. Ideen, Fakten und andere Grundbausteine des Wissens können nicht besessen werden. Eine Ausweitung des Urheberrechts zur Kontrolle von KI-Training birgt das Risiko, Innovation und den Zugang zu Wissen zu ersticken. Diese Erkenntnis ist zentral für das gesamte Projekt. Anstatt auf rechtliche Verbote und Einschränkungen zu setzen, verfolgen CC Signals einen anderen Ansatz: Sie setzen auf geteilte Erwartungen und verantwortliche Wiederverwendung. Jede praktikable Lösung muss rechtlich fundiert, technisch interoperabel und durch kollektives menschliches Handeln unterstützt sein.
Warum mehr kollektive Koordination nötig ist
Der vielleicht wichtigste Aspekt der CC Signals liegt in ihrer kollektiven Dimension. Gesellschaftliche Normen sind wohl der wichtigste Einzelaspekt menschlicher Governance. Sie bestimmen, wie wir uns verhalten, wie wir dazugehören und wie wir Entscheidungen in nahezu jedem Bereich unseres Lebens treffen. Normen können mächtig sein, aber sie erfordern kollektives Handeln. Wie Sarah Hinchliff Pearson, die Rechtsleiterin von Creative Commons, es formuliert: „Eine einzelne Präferenz, die auf einzigartige Weise zum Ausdruck gebracht wird, ist im Maschinenzeitalter belanglos. Aber gemeinsam können wir einen anderen Weg fordern.“ Creative Commons ist bewusst skeptisch gegenüber Ansätzen, bei denen Creators und Content-Sammlungen jeweils versuchen, die Nutzung ihrer Werke auf tausende verschiedene, inkompatible Weise zu gestalten.
Diese Erkenntnis ist zentral für das gesamte Projekt. Die Macht kommt von Koordination und Solidarität. Je mehr Sektoren und Gemeinschaften sich aufeinander abstimmen, desto mehr Einfluss gewinnen sie, um KI-Politik und -Praxis zu beeinflussen. Während ein einzelner Website-Betreiber oder Content-Ersteller wenig Einfluss auf das Verhalten großer KI-Unternehmen hat, können koordinierte Präferenzsignale durchaus Wirkung entfalten – sowohl aus praktischen als auch aus reputationsbezogenen Gründen.
Trotz der durchdachten Konzeption stehen CC Signals vor erheblichen praktischen Herausforderungen. Die erfolgreiche Einführung erfordert eine kritische Masse von Adoptoren – sowohl auf der Seite der Content-Ersteller als auch bei den KI-Entwicklern. Ohne breite Akzeptanz bleiben die Signale wirkungslos. Zudem muss das Framework technisch robust genug sein, um Manipulation zu verhindern, gleichzeitig aber einfach genug, um breite Adoption zu ermöglichen. Die Balance zwischen Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit wird entscheidend für den Erfolg sein. Rechtlich bewegt sich das Projekt in einem komplexen Umfeld verschiedener Jurisdiktionen mit unterschiedlichen Ansätzen zu Urheberrecht und KI-Regulierung. Die CC Signals müssen flexibel genug sein, um in verschiedenen rechtlichen Rahmen zu funktionieren.
CC Signals stellen für Creative Commons selbst einen wichtigen evolutionären Schritt dar. Die Organisation hat mit ihren traditionellen Lizenzen das offene Web geprägt, aber das KI-Zeitalter erfordert neue Werkzeuge. Der Ansatz bleibt der Philosophie des offenen Teilens treu, erweitert sie aber um Mechanismen für Reziprozität und Nachhaltigkeit. Das ist wichtig, weil reine Offenheit in einem Umfeld, wo wenige Akteure massive kommerzielle Vorteile aus gemeinsam geteilten Ressourcen ziehen können, möglicherweise nicht nachhaltig ist.
Mit der geplanten Alpha-Veröffentlichung (github) im November 2025 und der aktuell laufenden öffentlichen Konsultation befindet sich das CC Signals-Projekt noch in der Entwicklungsphase. Der Erfolg wird davon abhängen, ob es gelingt, eine breite Koalition von Stakeholdern für die Vision eines ausgewogeneren KI-Ökosystems zu gewinnen. Die Initiative kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Während sich die KI-Industrie rasant entwickelt und regulatorische Rahmen erst entstehen, haben gemeinschaftsbasierte Ansätze wie CC Signals das Potential, die Entwicklung in eine sozial verträglichere Richtung zu lenken. Letztendlich geht es bei CC Signals um mehr als nur technische Standards oder rechtliche Frameworks. Es geht um die Frage, welche Art von digitaler Gesellschaft wir wollen – eine, in der die Vorteile technologischer Innovation breit geteilt werden, oder eine, die von wenigen dominiert wird. Die Antwort liegt nicht nur in den Händen der Technologieunternehmen oder der Regulatoren, sondern auch in denen der Content-Ersteller und der digitalen Gemeinschaft insgesamt.